Am 30. Oktober 2025 fand das zweite interdisziplinäre Dermatologie-Symposium von PharmaKey.ch im Radisson Blu Hotel am Flughafen Zürich statt. Die Teilnehmenden wurden in den hellen Räumlichkeiten des Radisson Blu Hotels herzlich empfangen.
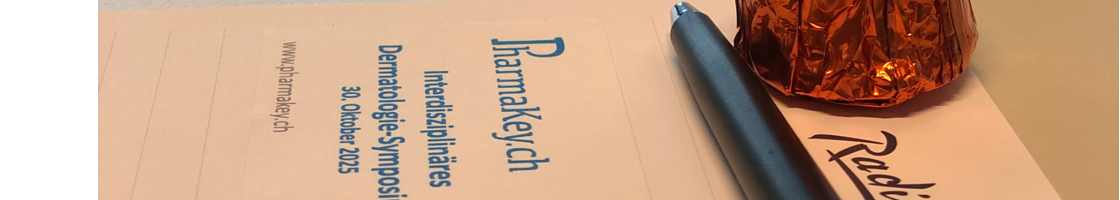
Rückblick auf das zweite interdisziplinäre PharmaKey.ch Dermatologie-Symposium
JAK-Inhibitoren: Neue Therapieoptionen mit Nebenwirkungs-Potenzial
Prof. Dr. Thomas M. Kündig, Klinikdirektor Dermatologie des Universitätsspitals Zürich eröffnete das interdisziplinäre Dermatologie-Symposium mit seinem Vortrag zu den JAK-Inhibitoren. Zu Beginn zeigte Prof. Kündig die Unterschiede zwischen klassischen Biologika (Antikörper gegen Interleukine) und den sogenannten Small Molecules wie JAK-Inhibitoren auf. Biologika agieren meist sehr spezifisch und greifen extrazellulär in einzelne Zytokinwege ein, weisen eine längere Halbwertszeit und kaum „off-target“-Effekte auf. Dagegen wirken Small Molecules intrazellulär, haben häufig ein breiteres Wirkungsspektrum, eine kürzere Halbwertszeit, aber potenziell dosisabhängige Nebenwirkungen. Anhand der atopischen Dermatitis zeigte Prof. Kündig die Rolle der JAK-vermittelten Signaltransduktion auf. Im Gegensatz zu Antikörpern, die gegen einzelne Interleukine gerichtet sind und somit einen spezifischen Signalweg blockieren, ermöglichen JAK-Inhibitoren, insbesondere JAK-1-Inhibitoren, eine umfassendere Hemmung der Signalübertragung mehrerer beteiligter Zytokine (TSLP, IL-4, IL-13, IL-22 und IL-31). Prof. Kündig strich heraus, dass dieser Unterschied als entscheidender Paradigmenwechsel bewertet wird. Anhand aktueller Studiendaten ging der Referent auf die wichtigsten JAK-Inhibitoren (Upadacitinib, Baricitinib, Abrocitinib) ein und zeigte das Potenzial aber auch das Nebenwirkungsrisiko auf. Ein Schwerpunkt lag auf der differenzierten Einschätzung des Nebenwirkungsprofils: JAK-Inhibitoren haben ein breites Spektrum potenzieller Nebenwirkungen, darunter Infektionen, Veränderungen im Blutbild (Lymphopenie, Neutropenie, Anämie), Leberfunktionsstörungen, thromboembolische Komplikationen und erhöhte Malignomraten. Prof. Kündig hob hervor, dass das Nebenwirkungspotenzial davon abhängig ist, welche Januskinase gehemmt wird resp. wie selektiv der jeweilige Wirkstoff ist. Eine Studie mit Tofacitinib, einem unspezifischen JAK-Inhibitor, bei Patienten und Patientinnen mit rheumatoider Arthritis zeigte ein erhöhtes Risiko für schwere kardiovaskuläre Ereignisse (MACE), venöse Thromboembolien und Malignome. In der Folge haben alle systemischen JAK-Inhibitoren eine entsprechende Warnbox in der Produktinformation erhalten, die auf diese Risiken aufmerksam macht. Zum Schluss ging Prof. Kündig noch auf die vielversprechenden topischen JAK-Inhibitoren, wie Delgocitinib bei Handekzem oder Ruxolitinib bei Vitiligo ein, die ein günstiges Sicherheitsprofil aufweisen.
Lebensbedrohliche, arzneimittelinduzierte Hautreaktionen
Im zweiten Vortrag des Abends ging Frau Dr. Meier-Schiesser, Leiterin der dermatologischen Poliklinik des Universitätsspitals Zürich, auf arzneimittelinduzierte, teils lebensbedrohliche Hautreaktionen ein.
Sie stellte die typischen und relevanten kutanen Arzneimittelreaktionen anhand von Bildern kurz vor:
- Anaphylaxie
- Makulopapulöses Arzneimittelexanthem
- “Symmetrical Drug-Related Intertriginous and Flexural Exanthema” (SDRIFE)
- Fixes toxisches Arzneimittelexanthem
- Stevens-Johnson-Syndrom (SJS) und Toxische epidermale Nekrolyse (TEN)
- “Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptom” (DRESS-Syndrom)
- Akute generalisierte exanthematische Pustulose (AGEP)
Im Anschluss wurden die einzelnen Arzneimittelreaktionen genauer besprochen. Bei der Anaphylaxie zeigte Dr. Meier-Schiesser die unterschiedlichen Schweregrade und typische Symptome auf: Von harmlosen Urtikaria-Reaktionen bis zum hypotonen Schock und Kollaps im Rahmen einer voll ausgeprägten Anaphylaxie. Daneben standen mögliche Auslöser – von Arzneimitteln über Insektengifte bis hin zu Nahrungsmitteln – und das Management mit Adrenalin, Sauerstoff- und Volumentherapie sowie Medikamenten wie z. B. Antihistaminika und Steroiden im Zentrum. Beim makulopapulösen Arzneimittelexanthem wies die Referentin darauf hin, dass der Beginn meist erst sieben bis vierzehn Tage nach der Einnahme des auslösenden Medikaments ist und differentialdiagnostisch v. a. virale Exantheme, inkl. Masern, Urtikaria und sekundäre Syphilis eine Rolle spielen. Sie betonte, dass in den meisten Fällen eine Therapie mit topischen Steroiden ausreicht. Bei der AGEP, einer akuten, meist sterilem pustulösen Hautreaktion, die innerhalb von 48 Stunden nach Medikamenteneinnahme auftritt, machte die Referentin auf die typischen Symptome wie z. B. Fieber und Neutrophilie aufmerksam. Auslösende Substanzen umfassen Aminopenicilline, Sulfonamide, Hydroxychloroquin und Chinolone, aber auch Terbinafin. Die Letalität liegt bei 1 bis 5 %. Im Management betonte sie das sofortige Absetzen des auslösenden Medikaments und die Behandlung je nach Schweregrad mit topischen oder systemischen Kortikosteroide sowie Anti-IL-17-Antikörpern und wies darauf hin, dass in schweren Fällen eine stationäre Behandlung notwendig sei. Beim DRESS-Syndrom, welches sich durch ein diffuses makulopapulöses und/oder pustulöses Exanthem zeigt, informierte Dr. Meier-Schiesser über weitere Symptome wie beispielsweise ausgeprägter Eosinophilie, Fieber und Gesichtsödem. Die Letalität beträgt 5 bis 10 %. Sie strich hervor, dass sich ein DRESS-Syndrom meist erst mehr als 3 Wochen nach der Medikamenteneinnahme entwickele, wodurch die Ursachensuche erschwert wird. Beim Management ist das sofortige Absetzen des (vermuteten) Auslösers wichtig. Die Betroffenen werden im Spital, teils intensivmedizinisch, betreut. Neben topischen und systemischen Steroiden kommen auch Anti-IL-5-Antikörper zum Einsatz. Die Referentin zeigte in der Folge auf, dass es sich bei SJS und TEN um ein Spektrum einer Erkrankung handelt und die Abgrenzung nach betroffener Körperoberfläche erfolgt: Während bei SJS weniger als 10 % der Körperoberfläche von einer Ablösung der Epidermis betroffen ist, sind es bei TEN >30 %. Die Letalität kann bis zu 35 % betragen. Zentral für die Versorgung sind die rasche Hautbiopsie, das sofortige Absetzen der Auslöser und die unterstützende Therapie auf Spezialstationen für Verbrennungen. Immunmodulatorische Ansätze wie hochdosierte, intravenöse Immunglobuline, systemische Steroide, Ciclosporin oder neuere Therapien mit Anti-TNF und JAK-Inhibitoren wurden als mögliche Optionen vorgestellt. Dr. Meier-Schiesser schloss ihren Vortrag mit “Red Flags” und betonte die Wichtigkeit des schnellen Handelns mit notfallmässiger Spitalzuweisung sowie sofortiger Hautbiopsie bei Verdacht auf eine schwere Arzneimittelreaktion.
Nach den beiden spannenden Vorträgen und lebhaften Diskussionen waren alle Teilnehmenden herzlich zum Apéro eingeladen. Die Aussteller L’Oréal SUISSE SA, LOUIS WIDMER AG, Incyte Biosciences International Sarl und Pfizer AG konnten sich über angeregte Gespräche mit den Anwesenden freuen. Das exquisite Buffet und die angenehme Atmosphäre luden zu anregenden Gesprächen mit den Ausstellenden, Referierenden und Kollegen und Kolleginnen ein.
Zwischen Beipackzettel und Bauchgefühl - Nebenwirkungsängsten souverän begegnen
Nach der Pause, begrüsste Natalia Blarer Gnehm, Fachapothekerin FPH Offizin und Medication Safety Officer, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu ihrem Vortrag “Nebenwirkungsängste der Patientinnen und Patienten”. Zum Einstieg zeigte sie den Warnhinweis, der in der Patienteninformation von Xeljanz zuoberst abgedruckt ist. Sie machte darauf aufmerksam, wie stark die möglichen schwerwiegenden Nebenwirkungen ins Auge springen und Patientinnen und Patienten verunsichert sein können - ebenso wie durch die Fülle an Informationen aus Presse, Internet, Social Media etc. Anhand der JAK-Inhibitoren zeigte Frau Blarer Gnehm auf, wie es aufgrund der “ORAL Surveillance Study” zu “Black box warnings” kam. Auch informierte sie über weitere Warnhinweise, wie das schwarze Dreieck (z. B. bei Paxlovid), welches eine zusätzliche Überwachung bei neuen Wirkstoffen, Biologika, bei befristeten Zulassungen oder bei Arzneimitteln mit Studienzulassungen kennzeichnet und der besondere Warnhinweis, wie er bei Isotretinoin aufgrund der Teratogenität angebracht ist. In der Folge wurden verschiedene Medikamente mit ihren Warnhinweisen, den Risiken sowie entsprechenden Auflagen und Informationen für Patientinnen und Patienten besprochen. Auch zeigte die Referentin auf, dass beispielsweise die Schweizerische Gesellschaft für Rheumatologie Lehren aus den DHCP gezogen und konkrete Richtlinien im Umgang mit den JAK-Inhibitoren veröffentlicht hat.
Im Anschluss widmete sich Blarer Gnehm dem erfolgreichen Patientengespräch und betonte die Wichtigkeit der patientengerechten Risikokommunikation, die evidenzbasierte Information und individuelle Beratung unter Einbezug von Fachwissen und Empathie.
Sie stellte in diesem Zusammenhang das Prinzip von NURSE vor:
- N für “Name”: Ansprechen der konkreten Themen und Emotionen
- U für "Understand": Emotionen verstehen und Verständnis zeigen
- R für “Respect”: Respekt und Akzeptanz zeigen
- S für “Support”: Unterstützung anbieten
- E für “Exploring”: Emotionen ergründen
Die Grundregeln der Kommunikation fasste die Referentin wie folgt zusammen: Gute Gesprächsvorbereitung, patientengerechte Sprache, faktenbasierte und transparente Information sowohl von Risiken als auch von positiven Wirkungen, Empathie, ernstnehmen von Ängsten und der Einbezug von Familienmitgliedern. So soll die Patientin resp. der Patient im Anschluss gemäss der “Teach-Back-Methode” in eigenen Worten wiedergeben was er/sie verstanden hat. Zudem sollten wichtige Punkte zusammengefasst, die nächsten Schritte vereinbart und offene Fragen geklärt werden. Zum Schluss strich Frau Blarer Gnehm die Schwierigkeit von Häufigkeitsangaben von Nebenwirkungen heraus und zeigte auf, wie anhand konkreter Zahlen und mit visuellen Hilfen die Risiken besser vermittelt werden können.
Mit einem wertvollen Fundus an neuem Wissen für den Berufsalltag machten sich die Teilnehmenden schliesslich auf den Heimweg. PharmaKey.ch blickt auf einen interessanten, interdisziplinären Austausch zurück, der nicht nur inspirierende Vorträge, sondern auch anregende Diskussionen und wertvolle Kontakte bot.